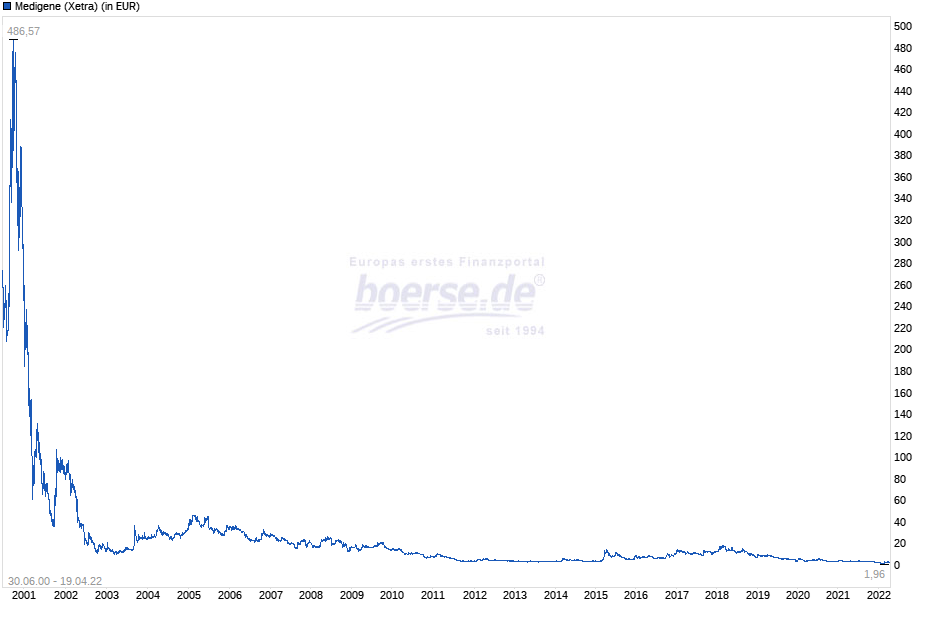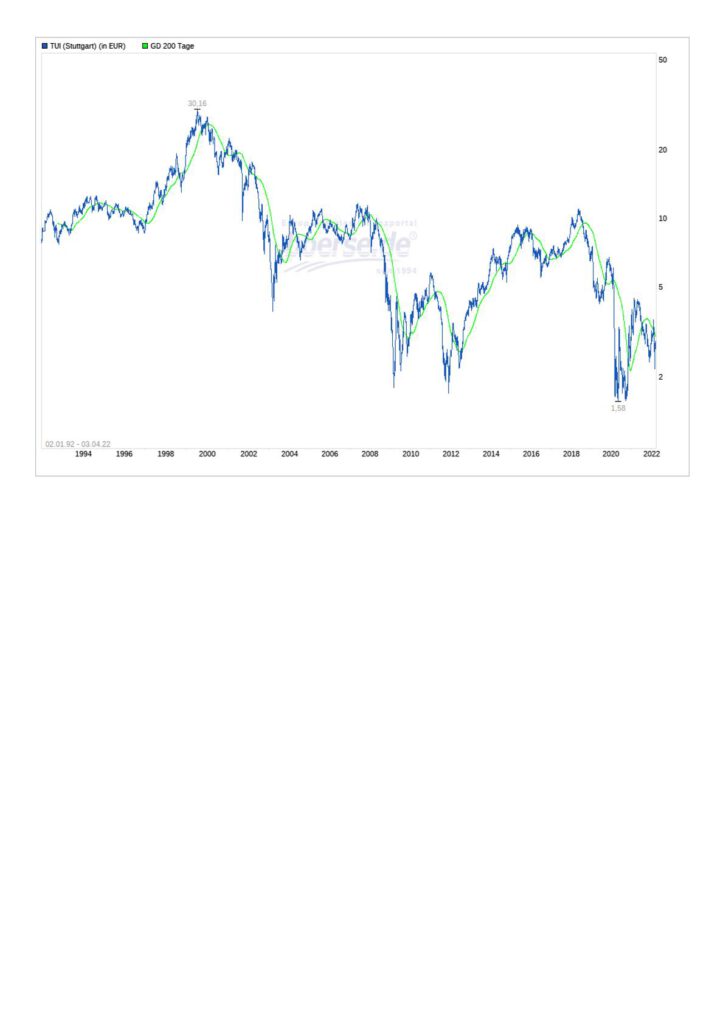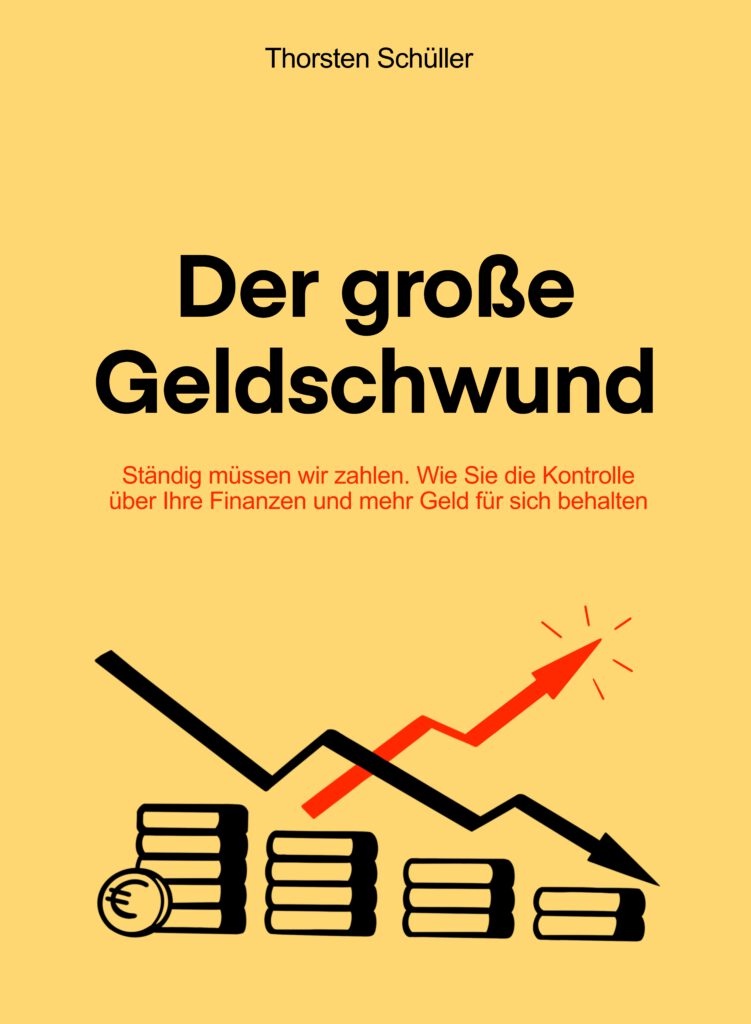Die israelische Regierung will die Palästinenser aus dem Gazastreifen vertreiben. Man könnte die Sache auch andersherum sehen und stattdessen erwägen, Israel zu verlegen.
Radikale Israelis fordern es schon lange, mittlerweile sprechen sich auch Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und US-Präsident Donald Trump für eine Umsiedelung der Palästinenser und dauerhafte Besetzung des Gazastreifens durch Israel aus. Doch was wäre, wenn man den Gedanken umdreht und Israel verlagern würde? Nach vielen Jahrzehnten an Konflikten, Kriegen und unzähligen Toten könnte darin ein alternativer Ansatz für Frieden liegen. Und vielleicht auch eine Lösung für den russisch-ukrainischen Krieg.
Als US-Präsident Donald Trump im Februar 2025 die Idee von der „Riviera des Nahen Ostens“ in die Welt setzte, meinte er damit den Wiederaufbau des Gazastreifens – aber ohne die Palästinenser. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu findet Gefallen an diesem Plan und fordert seitdem immer wieder eine zwangsweise Umsiedlung der Palästinenser sowie dauerhafte Besetzung des Gazastreifens. Damit ist er nicht weit weg von den Aussagen einiger rechtsextremer Regierungsmitglieder, die schon lange eine Vertreibung der Palästinenser verlangen.
Nun, Gedanken sind bekanntlich frei, selbst wenn sie das Existenzrecht einer ganzen Bevölkerungsgruppe infrage stellen. Dieser Freiheit der Gedanken folgend könnte man die Überlegungen Netanjahus, Trumps und der israelischen Rechtsextremen aber auch umdrehen und erwägen, anstelle der Palästinenser den Staat Israel umzusiedeln.
Dieser Gedanke mag absurd und ungeheuerlich erscheinen. Ein solches Vorhaben würde mit großer Wahrscheinlichkeit einen Sturm des Protestes auslösen. Tatsächlich aber könnte eine Umsiedelung Israels, die sich über Jahrzehnte erstrecken würde, Ruhe in einen nahezu ewigen Konflikt bringen.
Um es klarzustellen: Diese Überlegungen stellen nicht das Existenzrecht Israels infrage. Sie werfen aber die Frage auf, ob Israel am aktuellen Ort zwischen Libanon, Syrien, Jordanien und Ägypten, gut angesiedelt ist? Immerhin gibt es seit der Gründung des jüdischen Staates im Jahr 1948 immer wieder Kriege und Vertreibungen mit unzähligen Toten und unermesslichem Leid. Ein dauerhafter Frieden scheint heute weniger möglich als je zuvor. Mittlerweile kämpft Israel gar an mehreren Fronten – in wilder Zerstörungswut in Gaza, im Jemen, in Syrien, im Iran und in Katar. Offensichtlich sieht sich die israelische Regierung von Feinden umgeben. Selbst mit den Vereinten Nationen (UN), die 1947 immerhin den Weg zur Gründung Israel ebneten, ist das Verhältnis seit Längerem zerrüttet.
Gründung Israels machte Palästinenser zu Vertriebenen
Zwar ist das Gebiet von Palästina und dem heutigen Israel nicht erst seit dem Teilungsplan der UN Schauplatz von Auseinandersetzungen und Kämpfen. Muslime, Christen und Juden lieferten sich zuvor immer wieder Auseinandersetzungen, vier Jahrhunderte befand sich die Region unter osmanischer Kontrolle. Doch erst, nachdem britische Truppen im Ersten Weltkrieg das mehrheitlich von Arabern besiedelte Palästina eroberten und in der Folge der Zuzug von Juden, bedingt vor allem durch deren Verfolgung im Zweiten Weltkrieg, zunahm, verschärften sich die Auseinandersetzungen zwischen Teilen der jüdischen und der arabischen Bevölkerung.
Es war der 29. November 1947, als die UN-Generalversammlung der Empfehlung einer Kommission folgte, Palästina in einen arabischen und einen jüdischen Staat zu teilen und Jerusalem unter internationale Verwaltung zu stellen. Die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg schreibt dazu: „33 Staaten stimmten für die UN-Resolution, 13 votierten dagegen, darunter die sechs arabischen Mitgliedstaaten, zehn enthielten sich der Stimme. Die arabische Bevölkerung Palästinas lehnte den Teilungsplan ab, ebenso wie die anderen arabischen Staaten.“ Sie kritisierten, dass der Staat Israel „zulasten der arabischen Bewohner Palästinas verwirklicht werden und somit neues Unrecht begangen werden sollte. Ihrer Meinung nach hätten die Vereinten Nationen auch nicht das Recht, über Palästinas Zukunft gegen den Willen und auf Kosten der dort lebenden arabischen Mehrheit zu entscheiden.“ Die arabische Seite lehnte zudem eine Zwei-Staaten-Lösung und damit die Gründung eines palästinensischen Staates ab.
Am 14. Mai 1948, als die letzten britischen Truppen Palästina verließen, rief der Vorsitzende des Jüdischen Exekutivrats in Palästina, David Ben-Gurion, in Tel Aviv den Staat Israel aus. Es war zugleich der Beginn einer jahrzehntelangen Serie von Auseinandersetzungen und Gewalt. Noch im selben Jahr begann der erste arabisch-israelische Krieg, in dem viele Palästinenser ihre angestammte Heimat verloren. Schätzungsweise 700.000 Menschen flohen 1948/1949 aus dem heutigen Israel oder wurden vertrieben – ein Ereignis, dem die Palästinenser unter dem Begriff Nakba alljährlich gedenken.
Alle Konflikte, Kriege, Auseinandersetzungen zwischen Juden und Palästinensern der vergangenen 67 Jahre gehen im Grunde auf diese Gründungsgeschichte Israels zurück. Auf eine Staatsgründung, bei der der Wille jener Menschen, die mehrheitlich dieses Land wohnten, übergangen worden ist und die in der Folge zu Besetzten, Unterdrückten und Vertriebenen wurden. Erstaunt es, wenn daraus Wut und Hass entstehen?
Umsiedlung über 30 Jahre
Würde man nun die Ursache aller Nahost-Konflikte der vergangenen Jahrzehnte beseitigen und ein neues Siedlungsgebiet für Israel finden, sollte oder könnte das auch allen weiteren Auseinandersetzungen in der Region den Nährboden entziehen.
Doch wohin könnte Israel verlegt werden, wie und über welche Zeit sollte dieser Prozess ablaufen? Sinnvoll wäre die Umsiedlung des kleinen Staates in ein Land, welches über viel Platz verfügt und kulturell an der israelisch-jüdischen Mentalität näher dran ist als die arabische. Man könnte an die USA denken, die ohnehin ein enges Verhältnis zu Israel pflegen. Mit seiner Fläche von rund 22.000 Quadratkilometern würde Israel nicht einmal ein Dreißigstel von Texas beanspruchen. Erwägenswert wären aber auch Staaten wie Brasilien, Argentinien oder Russland, eventuell auch Kasachstan, Mexiko oder Kanada. Für Jerusalem, als wichtiges geistiges und religiöses Zentrum für Araber wie auch Juden, müsste sicherlich weiterhin ein Sonderstatus definiert werden.
Der Verlagerungsprozess selbst könnte beginnen, sobald Einigkeit über das neue Staatsgebiet gefunden worden ist. Ab dann sollte es möglich sein, über einen Zeitraum von beispielsweise 30 Jahren die Umsiedlung zu vollenden und im Anschluss das heutige Staatsgebiet Israel an die Palästinenser beziehungsweise Araber zu übergeben – ähnlich wie Hongkong 1997 vom Vereinigten Königreich an China übergeben worden ist. 30 Jahre sollten genug Zeit sein, neue Siedlungen und die Infrastruktur von Israel 2.0 aufzubauen. Die Menschen hätten damit zudem ausreichend Zeit, ihren Umzug zu planen und zu vollziehen. Es sollte aber auch gelten: Wer nicht umsiedeln möchte, kann bleiben, muss sich aber darauf einstellen, ab einem Stichtag in einem dann voraussichtlich palästinensisch-arabisch regierten Land zu leben.
Israel 2.0 – zwischen Ukraine und Russland?
Man könnte den Gedankenspielen ein – zugegebenermaßen gewagtes – hinzufügen: Das neue Israel findet seine neue Heimstatt auf Gebieten der heute umkämpften Ostukraine, idealerweise gepaart mit Anteilen von russischen Gebiet. Das mag abwegig und absurd klingen, könnte aber mehrere positive Effekte nach sich ziehen: Die Ansiedelung würde eine Beendigung der Kämpfe zwischen Russland und der Ukraine begünstigen. Beide Staaten hätten damit nach innen, zu ihren eigenen Bürgern, ein starkes Argument, die Auseinandersetzungen einzustellen. Zudem müsste vor der Staatsgründung von Israel 2.0 ein umfassender Friedensvertrag zwischen Russland und der Ukraine ausgehandelt werden – ebenso ein Vertrag, der die neue staatliche Souveränität und Unangreifbarkeit Israels regelt. Ein starker jüdischer Staat am Übergang zwischen Russland und der Ukraine könnte zudem ein Sicherheitsgarant für die Zukunft sein. So militärisch mächtig, wie sich Israel vor allem aktuell zeigt, dürften es weder Russland noch die Ukraine wagen, sich mit den neuen Nachbarn anzulegen. Das Ziel sollten vielmehr freundschaftliche und wirtschaftlich sowie kulturell enge Beziehungen sein, die sowohl für die Ukraine wie auch für Russland von großem Vorteil wären.
Zweifel, Fragen, Herausforderungen
Natürlich ist es eine verwegene Idee, einen ganzen Staat umzusiedeln. Und überhaupt, wieso gerade Israel, das den Juden nach ihren traumatischen Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg eine Heimat bietet? Man könnte darauf antworten: Benjamin Netanjahu hat mit den Palästinensern nichts anderes vor. Im Übrigen ist die Menschheitsgeschichte voll von Auseinandersetzungen, bei denen Grenzen verschoben, Millionen Menschen vertrieben und Staaten ausgelöscht worden sind. Nicht zuletzt ist das heutige Israel selbst das Ergebnis einer Neugründung auf fremdem Terrain, durchgesetzt gegen den Willen der Menschen, die mehrheitlich dort lebten.
Man könnte weiter fragen, warum die Israelis – und insbesondere Ultraorthodoxe und Radikale – einem solchen Plan zustimmen sollten? Warum sollten die Ukrainer, die in den von Russland besetzten Gebieten leben, zustimmen? Warum die ukrainische Regierung, die damit final der Abtretung von Gebieten zustimmen würde? Welchen Grund könnte Moskau haben, grünes Licht für solch einen Plan zu geben, der das Ende weiterer territorialer Ansprüche bedeuten würde? Warum sollte Moskau noch weiter gehen und eigenes Territorium an einen neuen Staat Israel abtreten? Und wieso sollte der große Israelfreund USA einem derartigen Megaprojekt zustimmen, verbunden mit allen Mühen und Unwägbarkeiten, die es mit sich bringen würde?
Nun, die Antwort in all diesen Fällen könnte lauten: Weil damit eine neue und auch neuartige Chance besteht, Frieden, Sicherheit und klare Verhältnisse zu schaffen – im Nahen Osten wie auch in der Ostukraine. Auch wenn es Gruppen geben wird, die mit der territorialen Verschiebung des jüdischen Staates nicht einverstanden sind, könnten die Israelis doch endlich durchatmen und müssten nicht mehr in dauernder Alarmbereitschaft sein wegen all der Feinde um sie herum. Auch für die Menschen, deren Gebiete dem neuen Israel zugeschlagen werden, böte sich eine Chance auf anhaltenden Frieden in einem Staatsgebilde, welches – so die Voraussetzung – ihre Rechte, Kultur und Sprache achtet. Auch das übrige ukrainische Volk käme nach beinahe drei Jahren Krieg ebenfalls endlich zur Ruhe und hätte die Chance, wieder nach vorne zu schauen. Moskau wiederum könnte gesichtswahrend einen lästigen und langatmigen Konflikt beenden, der sich jederzeit auch zu einer Gefahr für die Machthaber im Kreml entwickeln könnte.
Bleibt noch die Frage, wer diesen riesigen Umzug und den jahrzehntelangen Aufbau einer neuen staatlichen Infrastruktur eigentlich bezahlen soll? Es wäre wohl eine Aufgabe für die Weltgemeinschaft, die sich vor Augen halten sollte, dass die Errichtung eines neuen Staates Israel in Frieden langfristig billiger sein dürfte als weitere Jahrzehnte an Krieg, Zerstörung und Vertreibung.